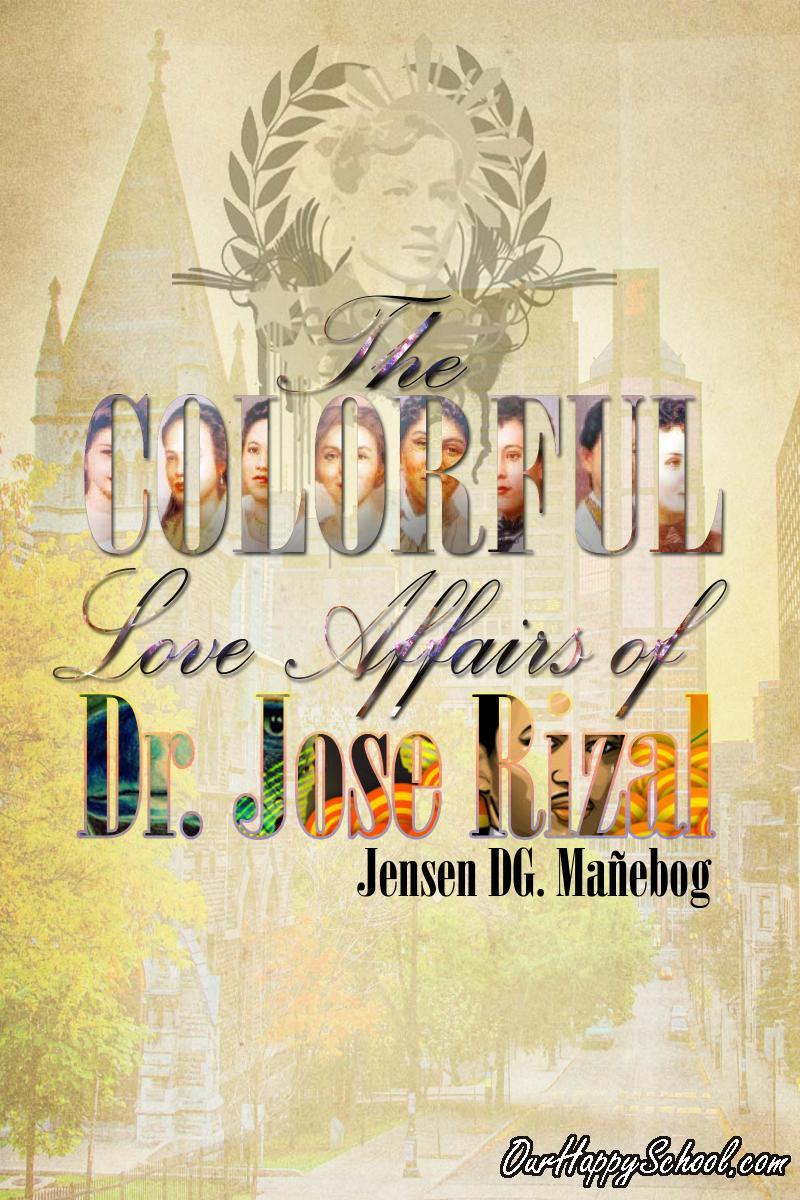Der 2. Mai 1986, ein Freitag, war in mehrfacher Hinsicht ein strahlender Tag in West- und in Ostberlin. Der Himmel war strahlend tiefblau, absolut wolkenlos. Am Morgen dieses Tages wippte ich auf meinem Klappstuhl im Auditorium Maximum im Henry Ford Bau der Freien Universität Berlin, balancierte einen linierten Schreibblock auf den Knien und zeichnete mit einem sehr feinen schwarzen Filzstift (0,05-Spitze, Edding) in die Marginalien meiner Notizen, während ich der Strafrechtsvorlesung Prof. Dr. Hermann Bleis mit relativer Aufmerksamkeit folgte. Die Figuren, welche die Ränder meines Heftes bevölkerten, waren in Zillemanier ausgeführt und erfreuten auch meine Sitznachbarn, die von Zeit zu Zeit hinüber spähten und unterdrückt lachten.
Die Vorlesung gab mir ausreichend Anregung zu meinen karikaturistischen Zeichnungen. Prof. Blei bevölkerte seine Fälle mit misogynen Charakteren, an denen wir die Grundzüge des Strafrechts deklinieren lernen sollten. Der Prof. war ein bayrisches Urgestein, er dozierte nicht, er polterte. Die von ihm gebildeten Lehrfälle zeugten von einer unapologetischen Altherrenphantasie. Hier traf ein Zuhälter namens Himmelsstoss auf einen Gynäkologen namens Prof. Dr. Frauenfeind, ein Zahnarzt trug den inspirierten Namen Dr. Deflorian. Der anzügliche Ton setzte sich bei den Frauennamen fort, hier agierten in unheilvoller und unappetitlicher Manier die Witwe Wüst und ihre Freundin, die Prostituierte Freudenreich, ihre kriminellen Neigungen an unschuldigen, schwächlichen Männern aus. Letztere wurden auch von einem Filmstar namens Busoni übervorteilt oder von diversen Ehefrauen zurechtgestutzt, welche sich Frau Emanz, Frau Freudlos oder Frau Unwirsch nannten. Deren – dem Personenstand naturgemäß freudlos – vermählten Ehemänner hießen Herr Sündermann, Herr Lüderjahn und August Geil.
Für Prof. Blei gab es, dies schien die eigentliche Essenz dieser Fälle, nur drei Motive für jegliches Verbrechen, drei Motive, an denen wir Diebstahl, Betrug, Raub, Körperverletzung, Totschlag und Mord in allen qualifizierenden Varianten messen sollten, drei Motive, die für ihn offenbar das gesamte übrige Leben, das strafrechtlich nicht relevante Menschengewimmel, umfassend und abschließend zu erklären vermochten. Geilheit, Geldgier. und Dummheit. In beliebiger Reihenfolge. Die Fallbeispiele zum untauglichen Versuch, zum Irrtum über Rechtfertigungsgründe oder zum dolus directus und dolus eventualis, die dies veranschaulichen sollten, und welche ich in den Marginalien der Notizen zu seinen Vorlesungen illustrierte, waren in ihrer konstruierten stereotypen Abstraktion wie versteinerte Weltentheater in Streichholzschachteln.
Prof. Blei, korpulent, Halbglatze, Hornbrille, war unter den Studenten und Studentinnen bekannt wie ein bunter Hund. Sein Ruf eilte ihn voraus und er arbeitete gewissenhaft und erfolgreich daran, ihn zu erhalten. Kommilitoninnen, die offensichtlich politisch engagierter waren als ich, und die sich über Prof. Blei (aber niemals, soweit ich erinnere, ihm persönlich gegenüber) letztlich zu Recht empörten und „Konsequenzen“ forderten, hielt ich entgegen, ich sei der Auffassung, man solle ihn doch vielmehr unter Denkmalschutz stellen und gewähren lassen. Soviel zur feministischen Solidarität. Der Prof. sei, so argumentierte ich und kam mir dabei geistreich vor, der Letzte einer aussterbenden Art, die neue Zeit stehe schon vor den Türen, und das könne und müsse gegenüber einem Fossil vergangener Tage wohl in gewisser Weise mild und versöhnlich stimmen. Nach Prof. Blei würden dann, das müsse uns klar sein, nur noch solche kommen, die ihren Misogynie wesentlich besser zu verkleiden verstehen würden. Mit Letzterem sollte ich Recht behalten.
Zwar gab es auch 1986 noch andere Profs, welche den Frauen in ihren Lehrfällen Namen wie „Berta Bummske (im folgenden: B)“ gaben, aber keinem von diesen gelang es wie Prof. Blei, auch seinen Kritikern wenn schon keinen Respekt, so doch jedenfalls von Zeit zu Zeit ein unwillkürliches Grinsen abzuringen. Das hatte weniger mit der Namensgebung in seinen Lehrfällen und seiner gesellschaftspolitischen Einstellung zu tun, als vielmehr mit seinem Gesamtauftreten, das aus einem Guss war. Der Mann war ein wandelndes Kuriositätenkabinett, in seiner Menschen- und Frauenverachtung eine Art spezialisierter, überzeichneter Kästner, kurz: ein Gesamtkunstwerk.
Die ZEIT hatte in einem im juristischen Fachbereich wohlbekannten Artikel zwei Jahre zuvor Bleis „Kuriositäten“ als „aggressive, unangenehme Überschreitungen des üblichen juristischen Schenkelklopf-Humors“ bezeichnet. Und doch: hier stand er vor uns, und fabulierte und dozierte mit unverminderten Geschmack an der Grenzüberschreitung weiter. Den änderte keiner mehr, keine Studentenkritik, die ihm die Fantasie eines dilettierenden Pornoschreibers in einer Fachpublikation attestiert hatte, keine Artikel in der ZEIT, auch nicht die Distanz feingeistiger Kollegen.
Nicht diese Überschreitung, der mehr menschen- als allein frauenverachtende, aus dem Ruder gelaufene Kalauer, aber diese polternde Unbeirrbarkeit, unterhielten mich insgeheim. Den Mann zu mögen, war ein früher Fall von political Uncorrectness, dessen war ich mir bewusst. Ich hörte dem Urgestein angeregt zu, amüsierte mich und zeichnete. Ich war ziemlich gut in strafrechtlicher Dogmatik. Prof. Blei konnte man ohne weiteres zwei Stunden zuhören, nicht nur wegen seiner bayrischen Farbigkeit und ungezügelten Lust am Schlüpfrigen. Er war, so schien es, gern im Hörsaal, das traf nicht auf alle unsere Dozenten und Professoren zu. Prof. Blei, trotz politisch kontroverser Positionen, konnte Recht unterrichten.
Wir saßen im Audimax, zwanzig Jahre zuvor das Zentrum der Berliner Studentenproteste. Die Achtundsechziger Studentenbewegung und ihre politischen Unruhen und Verwerfungen war ein Werk unserer Eltern, ihre Proteste in unseren Augen Diskussionen von gestern, derer wir müde waren. An der Universität Berlin herrschte jedenfalls unter den Studierenden der Rechtswissenschaft wieder beflissene, neutrale Strebsamkeit. Wir trugen blaue Rollkragenpullover und Perlenohrringe, und lächelten über Socken in Birkenstocksandalen.
Dabei war Berlin war immer noch geteilt. Der Kalte Krieg dauerte an und wir waren mittendrin und nach zwanzig Jahren politischen Aufbegehrens unserer Eltern weitgehend ahnungslos. Der NATO-Doppelbeschluss, welcher die Aufstellung neuer mit Atomsprengköpfen bestückter Raketen und Marschflugkörper – Pershing II und BGM-109 Tomahawk – in Westeuropa vorsah, war trotz massiver Proteste der Bevölkerung nicht verhindert worden, und wir interessierten uns nicht weiter dafür. Joseph Beuys war im Januar desselben Jahres gestorben und mit ihm schien der letzte Wille zur leidenschaftlichen politischen Aktion endgültig zu Grabe getragen worden sein. Sein letztes Urteil über die Grünen: stinklangweilig!, beschrieb auch die neue Generation Studierender der FU.
Wir waren stinklangweilig. Politik wurde wieder in Bonn gemacht und wir mischten uns nicht ein. Auch an jedem strahlenden Morgen im Februar, pilgerten wir brav in unsere Vorlesungen, um zu erfahren, wie das Verhalten von August Geil gegenüber Berta Bummske strafrechtlich zu beurteilen sei. Ich saß in Prof. Bleis Vorlesung, zeichnete, ignorierte den strahlenden Himmel und tat so, als lebten wir nicht in einer Welt am Abgrund.
Nach der Vorlesung war es fast Mittagszeit. Studenten strömten aus den Vorlesungssälen des Henry-Ford-Baus Richtung Cafeteria im Hauptgebäude des Fachbereichs in der Van´t Hoff-Straße. Es war warm an diesem Maitag, und vereinzelt ließen sich Studenten wie gewohnt auf den Rasenflächen zwischen den Fachbereichsgebäuden nieder, aber die meisten mieden den verlängerten Aufenthalt im Freien und suchten zügig das Lehrgebäude in der Van´t Hoff-Straße auf.
Ich passte mein Tempo dem Strom von Studenten an, die zur Van-t-Hoff-Straße hinüberliefen, diesem seltsamen trägen Tempo der Masse, das auf einer universellen Trägheit beruht. Im Fachbereich leerte ich mein Schließfach und setzte mich auf eine Bank in der Wandelhalle, um meinen Schreibblock und meinen ziegelsteinschweren Schönfelder, eine fette Loseblattsammlung Deutscher Gesetze, in meiner Tasche zu verstauen. Ich wollte in nicht in der U-Bahn auf den ersten Blick als Jurastudentin erkennbar sein.
Um mich herum standen Studenten in kleinen Gruppen, die das neue Vokabular der letzten Tage aneinander ausprobierten und über leicht flüchtige Isotope, Jod-131, Cäsium-137 und Strontium-90 diskutierten, als wären wir an der TU bei den Physikern. Niemand hier wusste, was diese Vokabeln tatsächlich bedeuteten. Vor vier Tagen, am 28. April, war in dem schwedischen Kernkraftwerk Forsmark aufgrund alarmierender radioaktiver Messungen Alarm ausgelöst worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die radioaktive Wolke, welche sich über dem sowjetischen Kernkraftwerk Wladimir Iljitsch Lenin nahe der ukrainischen Stadt Prypjat nach einem offenbar katastrophalen nuklearen Unfall gebildet hatte, bereits über Polen und die baltischen Länder Richtung Skandinavien bewegt. Ebenfalls am 28. April hatte die sowjetische Nachrichtenagentur TASS erstmals kurz von einem „Zwischenfall“ beim Betrieb des Kernkraftwerks Tschernobyl, zwei ganze Tage zuvor, nämlich am 26. April, berichtet. Zu dieser Zeit hatte der „Zwischenfall“ wahrscheinlich bereits eine Aktivität von mehreren Trillionen Becquerel freigesetzt.
Der Himmel über Berlin strahlte. In den Medien herrschte milde bis ausgedehnte Desinformation, die in erster Linie der Beschwichtigung diente. Der Berliner Bürgermeister Diepgen ging persönlich Gemüse und Salat einkaufen, und ich überlegte, ob ich die Einladung zu einer Party im Studentendorf Dahlem an diesem Abend annehmen sollte. Der Himmel strahlte, aber für die nächste Woche war Regen vorhergesagt, welche den radioaktiven Staub in die Stadt hinunterwaschen würde. Zuvor aber ein sommerlich warmes Wochenende.
Das tröstliche Wort „Zwischenfall“, übersetzt aus der kargen Meldung der Sowjets und aufgegriffen von deutschen Politikern und Nachrichtensprechern konkurrierte in den Diskussionen in der juristischen Wandelhalle mit dem weniger tröstlichen Begriff Wort Super-GAU, ebenfalls neu in unserem Vokabular.
Das sei alles nicht so wild, kein Grund zur Panikmache, dozierte ein blauer V-Ausschnitt über gestärktem Hemdkragen, drittes Semester. Zwischenfälle in AKWs seien im Szenario auslegungsüberschreitender Störfälle bereits vorhergesehen und es gäbe gute Notfallpläne. Er werde in nächster Zeit einfach nicht so viel frisches Zeugs essen. Unfälle seien bei der Auslegung kerntechnischer Anlagen und Prüfung der kerntechnischen Zulassung bereits anzunehmen, dies sei doch glasklar.
Ich starre kurz hinüber. Die Selbstsicherheit, mit der der blaue Feinstrick-Pullover dies vorträgt, ist verblüffend. Innerhalb von vier Tagen ist er zum Experten für die nukleare Sicherheit in West-Deutschland und zu seinem eigenen Propagandaministerium avanciert. Er legt seinen Zuhörern eindringlich dar, warum wir hier, in Westdeutschland und in Westberlin sicher sind, wir haben die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), eine technisch-wissenschaftliche Forschungs- und Sachverständigenorganisation mit rund 450 Mitarbeitern, davon mehr als 350 Wissenschaftlern. Deren Hauptaufgabe bestehe darin, die Sicherheit technischer Anlagen zu bewerten und zu verbessern und den Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren und Risiken solcher Anlagen weiterzuentwickeln.
Wie ein Echo zu seinen Worten höre ich General „Buck“ Turgidson aus Dr. Strangelove: „The Russkie talks big, but frankly, we think he’s short of know how. I mean, you just can’t expect a bunch of ignorant peons to understand a machine like some of our boys.“
Der Feinstrickpulli fügt nicht explizit hinzu, dass nukleare Strahlung sich auf den Kompetenzbereich der jeweils zuständigen Behörden beschränkt und an der Berliner Mauer geflissentlich und gehorsam kehrmacht, aber das ist die Essenz seiner Rede. Also, kein Anlass zur Sorge. Wenn ich mich auf der Party an den Rotwein halte, von denen manche meinen, dass er vor der Strahlenkrankheit schütze, und mich vom Salat fernhalte, bin ich auf der sicheren Seite. Jedenfalls bis der Regen kommt. Ich beschließe, auf die Party zu gehen, auch wenn ich keinen Rotwein mag.
Dennoch bin ich für einen Augenblick versucht, den Pulli nach der Van-’t-Hoff-Gleichung aus der Thermodynamik zu fragen, die den Zusammenhang zwischen der Lage des Gleichgewichts einer chemischen Reaktion und der Temperatur bei konstantem Druck beschreibt. Das sollte für den frischgebackenen naturwissenschaftlichen Experten eine einfache Frage sein, da unser Fachbereich seine Postadresse in der Van-Hoff-Straße hat, und würde ihm erlauben, sein Allgemeinwissen ebenso glänzend auszuführen wie sein neues naturwissenschaftliches Vokabular, das offenbar aus der Berliner Morgenpost stammt. Er wäre mir sicher sehr dankbar für die Gelegenheit. Ich entscheide mich dagegen, schlinge mir meine Ledertasche um die Schultern und spaziere zum Ausgang, während ich „Try a little tenderness“ aus Dr. Strangelove vor mich hinsumme.